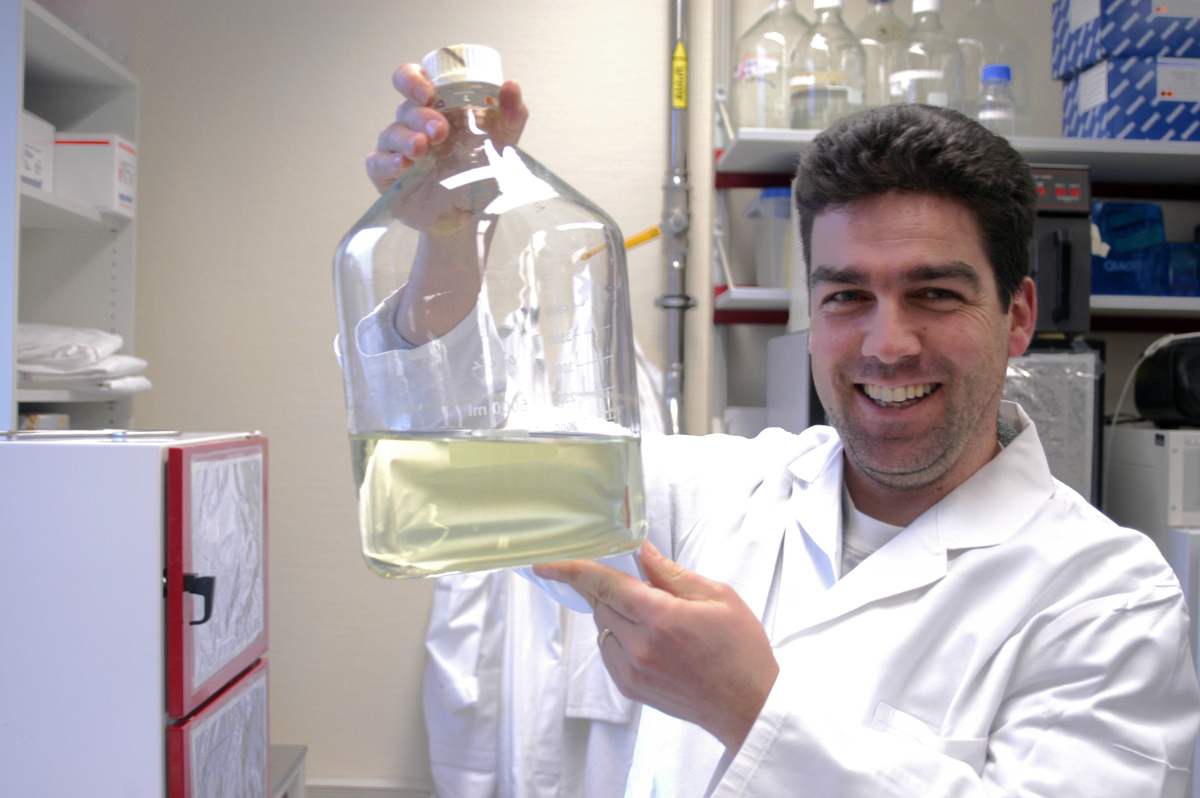Seitenpfad:
- Presse
- Pressemeldungen 2007
- Meeresbakterien mit Hybridmotor
Meeresbakterien mit Hybridmotor
Meeresbakterien mit Hybridmotor
Entschlüsselung des Genoms enthüllt verblüffende Eigenschaften eines Helgoländer Meeresbakteriums
Was sich in der Automobilbranche mit dem Hybridmotor erst langsam durchsetzt, hat sich in der Natur bereits seit Jahrmillionen bewährt - der Mix von verschiedenen Energiequellen. Während die eine Gruppe von Lebewesen wie Pflanzen und Algen ausschließlich mit Licht und dem in der Luft vorhandenen Kohlendioxid wachsen kann (durch die so genannte Photosynthese), benötigt die andere Gruppe, zu der zum Beispiel die Tiere und Pilze gehören, komplexe Nährstoffe (Kohlenhydrate, Proteine). Manche Lebewesen nutzen sogar einen Energiemix. Fehlen ihnen die Nährstoffe zum Wachsen, so können sie mithilfe des Sonnenlichts den Energiemangel zumindest zum Teil ausgleichen und so ihre Überlebenschancen erhöhen. Neueste Forschungen zeigen, dass bei Meeresbakterien der Energiemix mit Sonnenlicht weit verbreitet zu sein scheint (Photoheterotrophie). Jetzt haben Bremer Max-Planck-Wissenschaftler zusammen mit ihren deutschen und amerikanischen Kollegen das Genom eines neuartigen Meeresbakteriums entschlüsselt und Gene gefunden, die auf einen lichtabhängigen Energiemix hindeuten (PNAS, Februar 2007).
Entschlüsselung des Genoms enthüllt verblüffende Eigenschaften eines Helgoländer Meeresbakteriums
Was sich in der Automobilbranche mit dem Hybridmotor erst langsam durchsetzt, hat sich in der Natur bereits seit Jahrmillionen bewährt - der Mix von verschiedenen Energiequellen. Während die eine Gruppe von Lebewesen wie Pflanzen und Algen ausschließlich mit Licht und dem in der Luft vorhandenen Kohlendioxid wachsen kann (durch die so genannte Photosynthese), benötigt die andere Gruppe, zu der zum Beispiel die Tiere und Pilze gehören, komplexe Nährstoffe (Kohlenhydrate, Proteine). Manche Lebewesen nutzen sogar einen Energiemix. Fehlen ihnen die Nährstoffe zum Wachsen, so können sie mithilfe des Sonnenlichts den Energiemangel zumindest zum Teil ausgleichen und so ihre Überlebenschancen erhöhen. Neueste Forschungen zeigen, dass bei Meeresbakterien der Energiemix mit Sonnenlicht weit verbreitet zu sein scheint (Photoheterotrophie). Jetzt haben Bremer Max-Planck-Wissenschaftler zusammen mit ihren deutschen und amerikanischen Kollegen das Genom eines neuartigen Meeresbakteriums entschlüsselt und Gene gefunden, die auf einen lichtabhängigen Energiemix hindeuten (PNAS, Februar 2007).
Mit einer Häufigkeit von bis zu 10% spielen diese Photoheterotrophen eine nicht zu unterschätzende Rolle im globalen Stoffkreislauf der Ozeane. Erst kürzlich untersuchten Meeresbiologen am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen eine in den Küstenregionen weit verbreitete Bakterienart mit Hilfe der Genomanalyse. Den auf den Namen „Congregibacter litoralis KT71“ getauften Organismus isolierten sie vor rund acht Jahren aus Gewässern um Helgoland und stuften ihn nach Wachstumsexperimenten als heterotroph ein: KT71 braucht organische Kohlenstoffverbindungen. Die Überraschung kam durch die DNA-Sequenzierung am Craig Venter Institute in den USA. Die Analyse des mehr als 4 Millionen Basenpaare umfassenden Genoms ließ die Forscher stutzig werden. Sie fanden die Gene für den kompletten bakteriellen Photosyntheseprozess und machten daraufhin die Probe aufs Exempel. Aufwändige Wachstumsversuche in den Laboren der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braunschweig bestätigten die genetischen Befunde: Congregibacter litoralis KT71 ist in der Tat photoheterotroph und kann neben Proteinen und bestimmten Zuckerarten auch Licht als Energiequelle nutzen. Wie die Forscher vermuten, schaltet es dabei je nach den Bedingungen in seiner Umwelt von „Verbrennung“ auf „Photovoltaik“ um. „Fingerabdrücke“ einer neuen Gruppe von Bacteriochlorophyll-haltigen Gammaproteobakterien wurden vor 5 Jahren entdeckt. Jetzt stellte sich Congregibacter als erster im Labor kultivierbarer Vertreter dieser Gruppe von photoheterotrophen Meeresbakterien heraus. Der Stamm KT71 kann noch mehr. In schlechten Zeiten mit geringem Nährstoffangebot kann es auf seine intern angelegten Speicherstoffe zurückgreifen. KT71 bildet auch gerne Aggregate und hat eine Vorliebe für niedrige Sauerstoffkonzentrationen.
„ Damit ist KT71 perfekt an die rasch wechselnden Lebensbedingungen in der norddeutschen Bucht angepasst und kann zu Recht als ein typischer Vertreter der Meeresbakterien um Helgoland bezeichnet werden, “ betont Prof. Dr. Rudolf Amann, Direktor am Max-Planck-Institut. Sein Mitarbeiter Dr. Bernhard Fuchs ergänzt: „Hat sich eine Strategie als erfolgreich erwiesen, setzt sie sich auch durch. Diese Bakterien finden wir weltweit in den Schelfgebieten der Ozeane.“ Die Forscher hatten Glück. Ohne die Genomdaten wäre KT71 als einer von vielen heterotrophen Organismen in der Versenkung verschwunden. Ihr Dank geht deshalb an die private Gordon und Betty Moore Foundation, durch deren großzügige Unterstützung die Sequenzierung dieses Genoms ermöglicht wurde.
Manfred Schlösser
„ Damit ist KT71 perfekt an die rasch wechselnden Lebensbedingungen in der norddeutschen Bucht angepasst und kann zu Recht als ein typischer Vertreter der Meeresbakterien um Helgoland bezeichnet werden, “ betont Prof. Dr. Rudolf Amann, Direktor am Max-Planck-Institut. Sein Mitarbeiter Dr. Bernhard Fuchs ergänzt: „Hat sich eine Strategie als erfolgreich erwiesen, setzt sie sich auch durch. Diese Bakterien finden wir weltweit in den Schelfgebieten der Ozeane.“ Die Forscher hatten Glück. Ohne die Genomdaten wäre KT71 als einer von vielen heterotrophen Organismen in der Versenkung verschwunden. Ihr Dank geht deshalb an die private Gordon und Betty Moore Foundation, durch deren großzügige Unterstützung die Sequenzierung dieses Genoms ermöglicht wurde.
Manfred Schlösser
Originalveröffentlichung:
Bernhard M. Fuchs, Stefan Spring, Hanno Teeling, Christian Quast, Jörg Wulf, Martha Schattenhofer, Shi Yan, Steve Ferriera, Justin Johnson, Frank Oliver Glöckner and Rudolf Amann. PNAS, February 2007 "Characterization of a marine gammaproteobacterium capable of aerobic anoxygenic photosynthesis"
Rückfragen an:
Bernhard M. Fuchs, Stefan Spring, Hanno Teeling, Christian Quast, Jörg Wulf, Martha Schattenhofer, Shi Yan, Steve Ferriera, Justin Johnson, Frank Oliver Glöckner and Rudolf Amann. PNAS, February 2007 "Characterization of a marine gammaproteobacterium capable of aerobic anoxygenic photosynthesis"
Rückfragen an:
Gruppenleiter
Forschungsgruppe Durchflusszytometrie
MPI für Marine Mikrobiologie
Celsiusstr. 1
D-28359 Bremen
|
Raum: |
2222 |
|
Telefon: |

Geschäftsführender Direktor
MPI für Marine Mikrobiologie
Celsiusstr. 1
D-28359 Bremen
|
Raum: |
2221 |
|
Telefon: |

Presseprecher